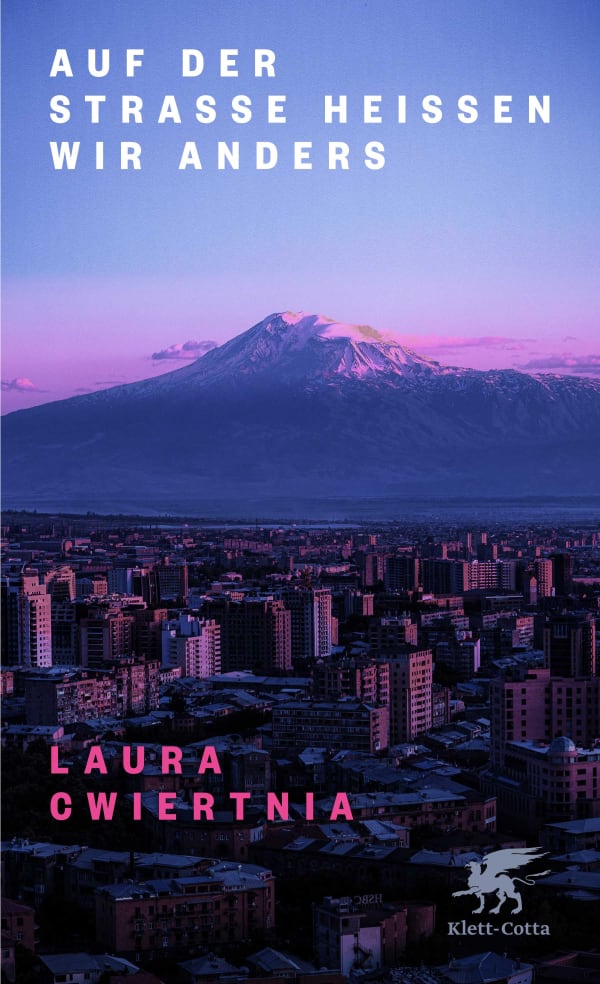Laura Cwiertnia: Auf der Straße heißen wir anders. Roman
Laura Cwiertnia ist die Tochter eines armenischen Vaters und einer deutschen Mutter. Sie stammt aus Bremen. Die stellvertretende Ressortleiterin bei der ZEIT hat jetzt mit »Auf der Straße heißen wir anders« ihren ersten Roman vorgelegt.
Karla wohnt im Norden von Bremen. Sie wächst hier als Kind auf, aber ihre Verwandten fühlen sich hier immer noch fremd. Ihr Vater Avi war in einer Klosterschule in Jerusalem. Die Urgroßmutter Armine stammt aus Istanbul. Ihre Herkunftsorte sind so unterschiedlich und prägen alle künftigen Generationen, indem sie auch ein Teil ihrer Identität werden.
Alle Kinder der Hochhaussiedlung in Bremen-Nord wissen ganz genau, wo jede/r herkommt. Albanien, Türkei, Russland. Karla weiß, dass sie in dieses Schema nicht hineinpasst. In den 60ern kommt ihre Großmutter als Gastarbeiterin aus Istanbul nach Deutschland. Und Karla weiß mittlerweile, dass die Familie armenische Wurzeln hat. Das wird aber in der Familie nie thematisiert. Aus irgendwelchen Gründen wird nie darüber gesprochen.
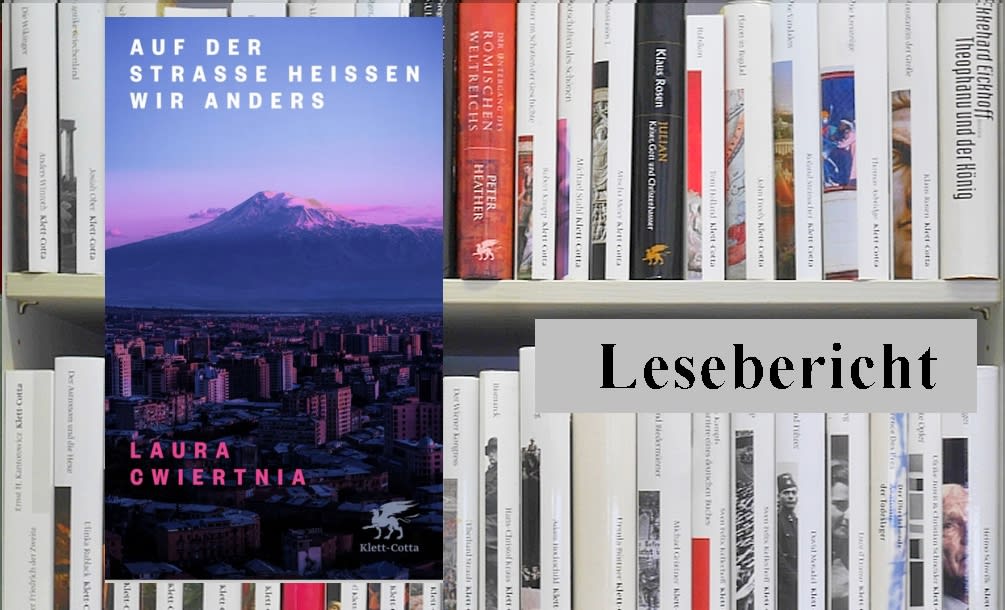
Nach dem Tod der Großmutter und ihrer Beerdigung trifft sich Karla mit ihrem Vater in ihrer Wohnung. Erinnerungen werden wach. Sie verteilen einige Habseligkeiten, auf denen der Name des Empfängers klebt. Als sie die Wohnung verlassen, fragt Karla ihren Vater: „Fährst du mit mir nach Armenien, Papa?“ (S. 41)
Rückblende. Ein Kapitel berichtet über Karlas Einschulung. Sie, die mit ihrer Kurzhaarfrisur auffällt. Ihre Mitschüler erzählen von ihren Ferien, sie stockt, die Lehrerin fragt, „Du warst in Deutschland?“ und Nina bestätigt: „Sie kann ja nicht nach Hause fahren.“ Bremen-Nord sei ihr Zuhause.
Auf dem Flughafen, vor dem Abflug erzählt ihr Vater ihr von Lilit Kuyumcyan, der Name, den Oma auf ihre Liste gesetzt hatte ... . Der Familienname sei der Nachname Karlas Urgroßmutter. So langsam kann Karla die Mosaiksteine zusammensetzen. Dann beginnt ihre Reise nach Armenien.
Neue Rückblende. Karlas Vater Avi und seine Jugendjahre in Istanbul. Später schickt ihn sein Vater nach Jerusalem in ein Internat, wo die Priester mit den Jungen Armenisch reden. Aber in Armenien war er noch nie gewesen. Er wird trotzig und schafft es, dass er wieder nach Hause, nach Istanbul fliegen darf.
Sie landen in Yerevan. Sie erkunden die Stadt und kommen schließlich in ihrer Ferienwohnung an. Der Vermieter Tigran erwartet sie dort und fragt nach dem Zweck ihrer Reise: „Wir wollen unsere Heimat sehen. Wissen Sie, ich bin auch Armenier.“ (S. 87) – Die Sprache ist auch ein Teil der Identität und Karlas Vater findet seine Wörter wieder. Er berichtet Karla von seinen drei oder vier Jahren in Jerusalem, wo er zum ersten Mal etwas von Armenien erfahren habe.
Noch ein Mosaikstein. Maryam ist die armenische Großmutter von Karla, die sich in den 20er-Jahren mit einem Arbeitsvertrag auf den Weg nach Deutschland gemacht hatte. Später lernt sie dort Klaus kennen … der mit ihrer armenischen Herkunft so gar nichts anfangen kann.
Karla und ihr Vater erkunden ihr Land, die Erinnerungen überwiegen. Die Orte erinnern an die Herkunft ihrer Vorfahren und beide erleben das Gefühl, hier nicht so richtig dazuzugehören. Ihre nächste Station sind die zwölf Steinblöcke des Denkmals, das an den Völkermord an den Armeniern erinnert, der Zizernakaberd. Karla erinnert sich, wie sie in der 7. Klasse vom Völkermord an ihren Vorfahren erfahren hat: Jungtürken hätten im Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Armenier ermordet. (vgl. S. 188)
Wie geht man mit dieser Geschichte um? Karlas und Avis Reise wirkt wie eine Suche nach einer verlorenen Zeit, die nicht wiedergefunden werden kann. Aber schließlich finden sie das Haus von Meline wieder, in dem Lilit gewohnt hat und Karla denkt an ihren Armreif mit den fünf goldenen Plättchen an winzigen Ösen, an den, den Meline von Lilit bekommen hat. Ein Detail, aber es weist daraufhin, dass die Erinnerungen auch durch die grausamen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten.
Identitäten kann man nicht auslöschen, man kann sie beschädigen, aber sie leben in der Literatur weiter und gerade die persönliche Geschichte von Avi und Karla liest sich wie ein stumme aber umso wirkungsvollere Anklage.
Heiner Wittmann
Auf der Straße heißen wir anders
Roman
Beteiligte Personen
Laura Cwiertnia
Laura Cwiertnia wurde 1987 in Bremen-Nord geboren und wuchs in einer deutsch-armenischen Familie auf. Sie hat in Köln und dem spanischen Granada studiert,...
Laura Cwiertnia wurde 1987 in Bremen-Nord geboren und wuchs in einer deutsch-armenischen Familie auf. Sie hat in Köln und dem spanischen Granada studiert, heute ist sie Redakteurin bei der ZEIT. »Auf der Straße heißen wir anders« ist ihr literarisches Debüt.
Das könnte Sie auch interessieren
Die Inkommensurablen
Die Inkommensurablen
Lesebericht: Julja Linhof, Krummes Holz
Lesebericht: Julja Linhof, Krummes Holz
Lesebericht: Iris Wolff, Lichtungen
Lesebericht: Iris Wolff, Lichtungen
Lesebericht: Pirkko Saisio, Das rote Buch der Abschiede
Lesebericht: Pirkko Saisio, Das rote Buch der...
"Nightbitch" in 5 Minuten!
"Nightbitch" in 5 Minuten!
Lesebericht und Interview: Zülfü Livaneli, Der Fischer und sein Sohn
Lesebericht und Interview: Zülfü Livaneli, De...
Raphaela Edelbauer im Gespräch zu ihrem neuen Roman »Die Inkommensurablen« bei der FAZ
Raphaela Edelbauer im Gespräch zu ihrem neuen...
Raphaela Edelbauer im Gespräch zu ihrem neuen Roman »Die Inkommensurablen« bei Deutschlandfunkkultur
Raphaela Edelbauer im Gespräch zu ihrem neuen...
Lesebericht: Nicola Denis, Die Tanten
Lesebericht: Nicola Denis, Die Tanten
Lesebericht: Lieke Marsman Das Gegenteil eines Menschen
Lesebericht: Lieke Marsman Das Gegenteil eine...
Interview mit Luisa Neubauer und Dagmar Reemtsma
Interview mit Luisa Neubauer und Dagmar Reemt...
Lesebericht: Mariam Kühsel-Hussaini, EMIL
Lesebericht: Mariam Kühsel-Hussaini, EMIL
Lesebericht: Elisabeth R. Hager, Der tanzende Berg. Roman
Lesebericht: Elisabeth R. Hager, Der tanzende...
Lesebericht: Tom Kummer, Unter Strom. Roman
Lesebericht: Tom Kummer, Unter Strom. Roman
Lesebericht und Interview: Miqui Otero, Simón. Roman
Lesebericht und Interview: Miqui Otero, Simón...
Lesebericht: Ines Geipel: Schöner Neuer Himmel. Aus dem Militärlabor des Ostens
Lesebericht: Ines Geipel: Schöner Neuer Himme...
Lesebericht: Torsten Schulz, Öl und Bienen
Lesebericht: Torsten Schulz, Öl und Bienen
Matthias Strobel übersetzt Guillermo Arriaga
Matthias Strobel übersetzt Guillermo Arriaga
Nachgefragt und Lesebericht: Johannes Laubmeier, Das Marterl
Nachgefragt und Lesebericht: Johannes Laubmei...
Nachgefragt und Lesebericht: Cynthia D’Aprix Sweeney, Unter Freunden
Nachgefragt und Lesebericht: Cynthia D’Aprix ...
Interview mit Howard Jacobsen
Interview mit Howard Jacobsen
Nachgefragt und Lesebericht: Michal Hvorecky, Tahiti Utopia. Roman
Nachgefragt und Lesebericht: Michal Hvorecky,...
Lesebericht: Pierre Lemaitre, Spiegel unseres Schmerzes. Roman
Lesebericht: Pierre Lemaitre, Spiegel unseres...
Nachgefragt und Lesebericht: Pierre Lemaitre, Die Farben des Feuers
Nachgefragt und Lesebericht: Pierre Lemaitre...
Lesebericht: Pierre Lemaitre, Opfer. Thriller
Lesebericht: Pierre Lemaitre, Opfer. Thriller
Michael Klett spricht über J. R. R. Tolkien, Der Herr der Ringe
Michael Klett spricht über J. R. R. Tolkien, ...
Nachgefragt und Lesebericht: Pierre Lemaitre, Drei Tage und ein Leben
Nachgefragt und Lesebericht: Pierre Lemaitre,...



Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt